Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im EWärmeG
Eine Heizungsanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme. Das spart Primärenergie und schützt so das Klima. Dazu werden Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Verbrennungs‑, Stirlingmotor oder einer Brennstoffzelle genutzt. Im Erneuerbare-Wärme-Gesetz sind nur hocheffiziente Anlagen im Sinne der EU-Richtlinie 2012/27/EU mit einem Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 % als Ersatzerfüllung anrechenbar.
KWK-Kleinanlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 20 kW erfüllen das EWärmeG komplett (15 %), wenn 15 kWh Strom pro m² Wohnfläche und Jahr parallel erzeugt werden. Eine pauschale Berechnung zur anteiligen Erfüllung ist möglich. Größere KWK-Anlagen mit über 20 kW elektrischer Leistung erfüllen das Gesetz vollständig, wenn der Wärmeenergiebedarf zu mehr als 50 % durch die KWK-Anlage abgedeckt wird. Auch größere Anlagen können nach Berechnung im Einzelfall anteilig angerechnet werden. Hierbei darf ein ggf. zusätzlich installierter Spitzenlastkessel nicht berücksichtigt werden.
Beispiel EFH
Exkurs: Stand der Technik – das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
Kraft-Wärme-Kopplung oder kurz KWK bezeichnet die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. In einem konventionellen Kraftwerk wird üblicherweise nur ca. ⅓ der eingesetzten Brennstoffenergie in Strom umgewandelt. Die restlichen ⅔ werden als Abwärme über den Kühlturm an die Umwelt abgegeben und somit nicht sinnvoll verwertet. Im Gegensatz dazu arbeitet eine KWK-Anlage deutlich effizienter, da sowohl der Strom, als auch die anfallende Wärme und somit der gesamte Brennstoff (fast) vollständig genutzt wird. So eine KWK-Anlage wird gewöhnlich Blockheizkraftwerk oder kurz BHKW genannt.
Einsatzorte von kleinen und großen BHKW
Der am häufigsten eingesetzte BHKW-Typ ist der Gasmotor. Dieser kommt aus dem LKW- oder PKW-Bereich und wurde auf den stationären Einsatz in einem BHKW weiterentwickelt und optimiert. Es werden aber alternativ auch Gasturbinen, Brennstoffzellen, Stirling-Motoren und andere Stromerzeugungsanlagen eingesetzt. Dementsprechend wird als Brennstoff überwiegend Erdgas verwendet; je nach Anforderung aber auch Öl, Flüssiggas oder Wasserstoff. In größeren Anlagen mit mehreren Megawatt (MW) elektrischer Leistung werden auch feste Brennstoffe wie Holz oder Kohle eingesetzt. Hierbei wird mit der Abgaswärme Dampf erzeugt und somit über eine Dampfturbine Strom produziert. Bei kleineren Anlagen werden auch ORC-Anlagen (ORC = Organic Rankine Cycle) eingesetzt. Dies ist auch ein Dampfprozess, jedoch wird hierbei ein anderes Medium als Wasser genutzt.
Im Wohnbereich werden die kleinsten BHKW eingesetzt. In einem Mehrfamilienhaus liegt die elektrische Leistung bei 5 bis 50 kW. In einem Ein- oder Zweifamilienhaus werden noch kleinere BHKW mit einer Leistung von 1 bis 5 kW eingesetzt.
Ein wirtschaftlicher Betrieb setzt einen ausreichenden Strom- und Wärmebedarf voraus, um auf hohe Nutzungsstunden des BHKW zu kommen. Hierfür wird das BHKW so ausgelegt, dass es die Grundlastwärme abdeckt. Leistungsspitzen im Winter können durch einen zusätzlichen Gaskessel abgedeckt werden.
Preise und Fördermittel
Aufgrund der hohen Effizienz werden BHKW finanziell gefördert. Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gewährt einen einmaligen Zuschuss je nach Anlagengröße und zahlt einen Zuschlag je erzeugter kWh Strom. Die Energiesteuer auf das im BHKW eingesetzte Erdgas wird auf Antrag zurückerstattet. Das Bundesland oder der örtliche Energieversorger haben teilweise noch zusätzliche Förderprogramme für KWK-Anlagen.
KWK-Anlagen haben ein sehr großes Einsatzspektrum. Neben dem Einsatz von Kleinstanlagen in Wohnhäusern nutzen Unternehmen die Wärme und den produzierten Strom von größeren BHKW auch direkt in ihrem Betrieb (Leistungsbereich 100 bis 5.000 kW). Hotels, Krankenhäuser und Schwimmbäder nutzen BHKW um Warmwasser, Heizwärme und Strom zu erzeugen (Leistungsbereich 5 bis 1.000 kW). Kraftwerke mit einer Größe von mehreren 100 MW elektrischer Leistung können die Abwärme auch in ein Wärmenetz einspeisen und den Strom in das öffentliche Netz einfließen lassen.
Anteilige Berechnung im EWärmeG – Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Eine anteilige Anrechnung ist durch die folgenden Formeln möglich:
Pauschale Berechnung für Kleinanlagen (≤ 20 kWel) nach § 11.2 Satz 3 EWärmeG
Anteil Ersatzmaßnahme [%] ≙ kWh/m² pro Jahr = elektrische Leistung [kW] × prognostizierte Volllastbetriebsstunden [h/Jahr] / Wohnfläche [m²]
Einzelfallberechnung für größere Anlagen (> 20 kWel) nach §§ 3 Nr. 4 und 20.6 EWärmeG
Anteil Ersatzmaßnahme [%] = produzierte Wärmemenge KWK [kWh] / gesamter Wärmeenergiebedarf [kWh] × 50 % × 15 %
Ist der Wert größer oder gleich 15 %, sind die Vorschriften vollständig erfüllt. Ansonsten ist die anteilige Erfüllung folgendermaßen zu berechnen:
Erfüllungsgrad [%] = Anteil Ersatzmaßnahme [%] / 15 % × 100 %
Verbindliche Aussagen zum EWärmeG nur von Ihrer unteren Baurechtsbehörde!
Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen – beispielsweise mit dem Sanierungsfahrplan
Bei einer wirtschaftlichen Auslegung der KWK-Anlage werden in der Regel die oben aufgeführten Vorgaben des EWärmeG (über)erfüllt. Falls dennoch nur eine anteilige Erfüllung mit dem BHKW zu erreichen ist, kann ein ggf. installierter (Spitzenlast)Gaskessel mit einem Biogasgemisch befeuert werden. Eine Kombination mit dem Sanierungsfahrplan oder tatsächlichen Dämmmaßnahmen können auch Sinn ergeben, da diese unabhängig von der Erzeugereinheit durchzuführen sind.
Um heraus zu finden, ob eine KWK-Anlage (BHKW) die für Sie ökonomisch und ökologisch beste Entscheidung ist (nicht zuletzt wegen den ggf. möglichen Förderungen), können Sie vor dem Heizungstausch kostengünstig einen Sanierungsfahrplan in Auftrag geben. Der Sanierungsfahrplan wird mit bis zu 50 % vom Staat gefördert (Eigenanteil ab 970 €) und bringt zusätzlich 5 % im EWärmeG.
Kundenmeinungen
4,8 von 5 Sternen auf SHOPVOTE und Google aus 66 Bewertungen (167 insgesamt). Hier eine kleine Auswahl von Kundenmeinungen:
Ernst Bauer
Google
5.00 von 5 Sternen
Estatika GmbH hat ein sehr kompetentes Team ! Vom Angebot, Erstgespräch, digitaler Ortstermin, Abschlussgespräch bis zur Fertigstellung des Sanierungsfahrplan ist alles super abgelaufen, kann ich nur weiterempfehlen.
ShopVoter-4010926
ShopVote
5.00 von 5 Sternen
sehr zu empfehlen
Über uns
Die ESTATIKA GmbH ist ein Büro für Energieberatung mit zertifizierten Energieeffizienz-Experten des Bundes. Wir bieten neben den klassischen Energieberatungsleistungen (bspw. Sanierungsfahrplan) auch Beratungsangebote zum EWärmeG/GEG, sowie zu Biogas-Tarifen an − um betroffenen Eigentümern konkrete wirtschaftliche Lösungen an die Hand zu geben.



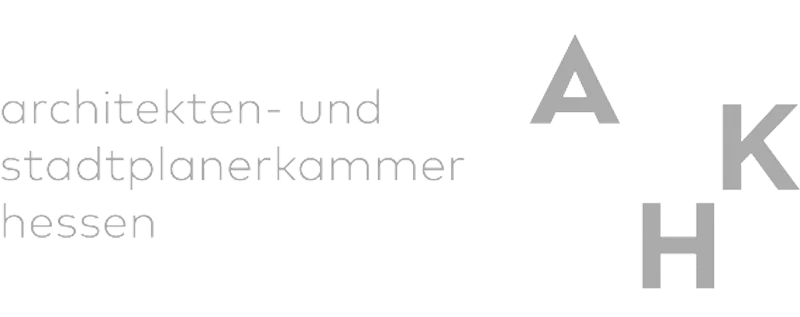
Unsere Ansprechpartner:

Dr.-Ing.
Christoph Ebbing
Energieeffizienz-Experte
–> EWärmeG & GEG

Dipl.-Vw.
Stefan Tiesmeyer
Energiewirtschaftler
–> Biogas-Tarife

Dipl.-Ing. (FH)
R. Sithamparanathan
Energieeffizienz-Experte
–> Sanierungsfahrplan
Unsere Keyfacts:
- Gründungsjahr
- 2019
- Berufsjahre
- 15+
- erfolgreiche Projekte
- 2.000+
Leistungen
Für folgende Leistungen können Sie bei uns Angebte einholen – zur Erfüllung des EWärmeG:






