Balkonkraftwerke und PV-Anlagen im EWärmeG
Balkonkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen (beides im Folgenden »PV-Anlage« genannt) werden nicht zur Wärmegewinnung, sondern zur Stromerzeugung eingesetzt. Wenn ein Wohngebäude-Eigentümer mit einer solchen PV-Anlage auf seinem Gebäudegrundstück selbst Strom produziert, kann dies im Erneuerbare-Wärme-Gesetz als Ersatzmaßnahme (anstatt einer »grünen« Wärmeversorgung) angerechnet werden – egal ob der Strom selbst genutzt oder in das Netz einspeist wird.
Damit das EWärmeG vollständig erfüllt ist (15 %), muss die PV-Anlage eine Spitzenleistung von mindestens 0,02 kWp pro m² Wohnfläche erbringen, unabhängig von der Anzahl der Wohneinheiten (Ein- oder Mehrfamilienhaus). Beispiel: Ein Einfamilienhaus mit 100 m² Wohnfläche muss somit 2 kWp Leistung, ein Mehrfamilienhaus mit 300 m² Wohnfläche 6 kWp Leistung installieren bzw. installiert haben.
Exkurs: Klassische PV-Anlagen vs. Balkonkraftwerke
»Klassische« PV-Anlagen sind großflächige Systeme, meist auf Dächern installiert, mit Leistungen von mehreren Kilowattpeak (kWp). Sie eignen sich, um den gesamten Strombedarf eines Hauses oder Unternehmens zu decken. Durch den Einsatz von Speichern und Energiemanagementsystemen wird der Eigenverbrauch optimiert, insbesondere für Anwendungen wie Elektroautos oder Wärmepumpen. Überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist werden, was zusätzliche Einnahmen generiert. Trotz höherer Investitionskosten bieten PV-Anlagen durch Einsparungen und Förderprogramme eine langfristige Wirtschaftlichkeit. Eine PV-Anlage muss an zwei Stellen angemeldet werden: beim örtlichen Netzbetreiber und online im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.
Balkonkraftwerke hingegen sind kompakte, kostengünstige im Einzelhandel zu erwerbende Systeme, zumeist bestehend aus ein bis zwei Modulen, mit einer Nennleistung rund 2 kW. Gesetzlich ist die Leistung des Wechselrichters auf 800 Watt begrenzt, um sie als steckerfertige Geräte nutzen zu können. Sie decken meist die Grundlast von Haushaltsgeräten wie Kühlschrank oder WLAN-Router und bieten eine einfache Installation, etwa auf Balkonen oder Terrassen. Wer ein Balkonkraftwerk installiert, muss es im Marktstammdatenregister registrieren.
Während PV-Anlagen größere Mengen Strom erzeugen und vielfältige Anwendungen unterstützen, punkten Balkonkraftwerke durch Flexibilität, geringe Einstiegshürden und die Möglichkeit, auch ohne Eigentum von Solarenergie zu profitieren.
Übergang vom EWärmeG zum GEG (»Heizungsgesetz«) beachten!
In Baden-Württemberg können Eigentümer von Wohngebäuden, die eine neue Gasheizung installieren, ihre Verpflichtung nach dem EWärmeG und künftig nach dem GEG durch Biogas-Tarife erfüllen. Die Anteile müssen nach dem Heizungstausch stufenweise steigen: zunächst 10 %*, ab 2029 15 %, ab 2035 30 %, ab 2040 60 % und ab 2045 100 % Biogas-Anteil.
* nur in Verbindung mit einem Sanierungsfahrplan (iSFP) oder einer anderen Option, die mindestens 5 % Erneuerbare Energien gemäß EWärmeG bringt.
Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen
Eine anteilige oder vollständige Erfüllung ist entsprechend der installierten Nennleistung der PV-Anlage möglich. Auch ältere Photovoltaik-Anlagen können berücksichtigt werden. Dies muss jedoch ebenfalls von einem Sachkundigen bestätigt werden.
Anteilige Berechnung im EWärmeG – Photovoltaik als Ersatzoption
Eine anteilige Anrechnung ist nach § 11.2 Satz 2 EWärmeG durch die folgende Formel möglich:
Anteil Ersatzmaßnahme [%] = installierte Nennleistung [kWp] / erforderliche Nennleistung [kWp] × 15 %
Der Erfüllungsgrad kann wie folgt berechnet werden:
Erfüllungsgrad [%] = Anteil Ersatzmaßnahme [%] / 15 % × 100 %
Bei einer bereits neu installierten Gas- oder Ölheizung ist ein Balkonkraftwerk eine beliebte, da kostengünstige, Alternative.
Verbindliche Aussagen zum EWärmeG nur von Ihrer unteren Baurechtsbehörde!
Kundenmeinungen
4,8 von 5 Sternen auf SHOPVOTE und Google aus 66 Bewertungen (167 insgesamt). Hier eine kleine Auswahl von Kundenmeinungen:
Cornel Leinenkugel
Google
5.00 von 5 Sternen
Wir sind mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans durch ESTATIKA sehr zufrieden. Der Kontakt war von Anfang an unkompliziert, transparent und vertrauensvoll. Der Preis war deutlich besser als von anderen Anbietern. Klare Empfehlung.
ShopVoter-1938574
ShopVote
5.00 von 5 Sternen
Energieausweis nicht nur super schnell bekommen, sondern auch zu einem top Preis. Vielen Dank!
Über uns
Die ESTATIKA GmbH ist ein Büro für Energieberatung mit zertifizierten Energieeffizienz-Experten des Bundes. Wir bieten neben den klassischen Energieberatungsleistungen (bspw. Sanierungsfahrplan) auch Beratungsangebote zum EWärmeG/GEG, sowie zu Biogas-Tarifen an − um betroffenen Eigentümern konkrete wirtschaftliche Lösungen an die Hand zu geben.



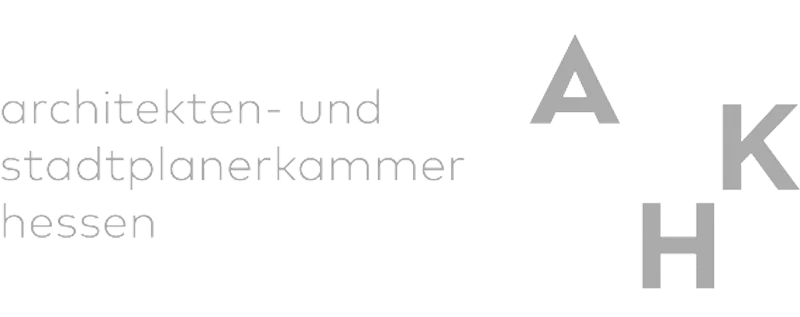
Unsere Ansprechpartner:

Dr.-Ing.
Christoph Ebbing
Energieeffizienz-Experte
–> EWärmeG & GEG

Dipl.-Vw.
Stefan Tiesmeyer
Energiewirtschaftler
–> Biogas-Tarife

Dipl.-Ing. (FH)
R. Sithamparanathan
Energieeffizienz-Experte
–> Sanierungsfahrplan
Unsere Keyfacts:
- Gründungsjahr
- 2019
- Berufsjahre
- 15+
- erfolgreiche Projekte
- 2.000+
Leistungen
Für folgende Leistungen können Sie bei uns Angebte einholen – zur Erfüllung des EWärmeG:






