Solarthermie im EWärmeG
Um das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg vollständig (15 %) mit einer thermischen Solaranlage zu erfüllen, muss ein Wohngebäude mit 1–2 Wohneinheiten pro m² Wohnfläche 0,07 m² Kollektorfläche (auch Aperturfläche genannt) aufweisen. Hat das fragliche Gebäude mehr als 2 Wohneinheiten genügen 0,06 m² pro m² Wohnfläche. Diese Zahlen beziehen sich auf verglaste Flach- und Röhrenkollektoren.
Werden dagegen effektivere Vakuumröhrenkollektoren eingesetzt, reduzieren sich die Werte um 20 % auf 0,056 m² bzw. 0,048 m² pro m² Wohnfläche.
Beispiel EFH/ZFH
Exkurs: Thermische Solaranlagen – Funktion und Nutzen
Thermische Solaranlagen nutzen Sonnenstrahlung zur Erwärmung von Trink- oder Heizungswasser. Sie bestehen aus Kollektoren, Solarleitungen, einem Solarregler und einem Wärmespeicher, angepasst an den Einsatzzweck. Eine Umwälzpumpe transportiert die erwärmte Solarflüssigkeit zum Speicher. Typische Speicherarten sind Pufferspeicher für Heizungswasser oder Kombispeicher für Heiz- und Trinkwasser. Da Solarthermie-Anlagen den Wärmebedarf nicht vollständig decken, werden sie meist mit weiteren Wärmequellen wie Wärmepumpen oder Gasheizungen kombiniert.
Die häufigste Anwendung ist die Trinkwassererwärmung, bei der der solare Deckungsgrad etwa 60 % beträgt. Im Sommer kann der gesamte Trinkwarmwasserbedarf gedeckt werden. Anlagen mit Heizungsunterstützung liefern zusätzlich Raumwärme, vor allem in den Übergangsmonaten. Im Winter übernehmen Zusatzheizungen den Großteil der Wärmeversorgung, während der solare Deckungsgrad auf 30–40 % sinkt.
Die Wirtschaftlichkeit hängt von Montage‑, Wartungs‑, Betriebs- und Stromkosten sowie möglichen Förderungen ab. Solarthermie-Anlagen sind in der Anschaffung entweder »günstig« für reine Warmwasseraufbereitung oder »teurer« bei zusätzlicher Heizungsunterstützung. Kombinierte Lösungen mit Gasheizungen gehören zu den kostenintensiveren Varianten.
Flachkollektoren bestehen aus einem isolierten Gehäuse, Rohren mit Solarflüssigkeit, einer Absorberfläche und einer Glasabdeckung. Die Absorberfläche nimmt Wärme auf, die über Rohre an den Speicher weitergeleitet wird. Die Wärmedämmung minimiert Verluste, während ein Frostschutzmittel in der Solarflüssigkeit ein Einfrieren verhindert. Vakuum-Röhrenkollektoren sind effizienter, da das Vakuum Wärmeverluste reduziert. Sie bestehen aus Glasröhren, die Wärme an eine Solarflüssigkeit weitergeben. Ihre höhere Effizienz ermöglicht kleinere Flächen, allerdings sind sie in der Anschaffung „teurer“ als Flachkollektoren. Manche Systeme verzichten sogar auf Frostschutzmittel.
Die Aperturfläche bezeichnet die gesamte von Sonne beschienene Glasfläche eines Solarkollektors. Die Aperturfläche bietet allerdings keine Aussage über die tatsächlich effektiv genutzte Fläche. Hierzu dient die Absorberfläche. Die Absorberfläche, auch Nettofläche genannt, bezeichnet nur die Fläche, die effektiv genutzt wird, um die Sonneneinstrahlung in Wärme umzuwandeln. Die Größe der Aperturfläche ist für die Erfüllung des EWärmeG relevant.
Verbindliche Aussagen zum EWärmeG nur von Ihrer unteren Baurechtsbehörde!
Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen
Zur vollständigen Erfüllung (15 %) des EWärmeG ist es ausreichend, nachzuweisen, dass die entsprechende Kollektorfläche installiert wurde. Werden die oben genannten Vorgaben nicht erreicht, kann auch eine anteilige Nutzung angerechnet werden. Statt dieser pauschalen Methode kann auch eine – aus praktischen Gründen unübliche – Einzelfallberechnung erfolgen. Auch ältere Anlagen können (ggf. anteilig) berücksichtigt werden. Eine Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen ist im EWärmeG gestattet.
Anteilige Berechnung im EWärmeG – Solarthermie
Wenn nicht der gesamte Wärmeenergiebedarf durch die Solarthermie-Anlage gedeckt wird, ist auch eine anteilige Anrechnung durch die folgenden Formeln möglich:
Pauschale Berechnung nach § 11.2 Satz 2 in Verbindung mit § 7 EWärmeG
Anteil Erneuerbare Energien [%] = installierte Kollektorfläche [m²] / erforderliche Kollektorfläche [m²] × 15 %
Einzelfallberechnung nach §§ 3 Nr. 4 und 20.6 EWärmeG
Anteil Erneuerbare Energien [%] = Solarertrag der Anlage [kWh] / (gesamter Wärmeenergiebedarf [kWh] × 15 %) × 15 %
Ist der Wert größer oder gleich 15 %, sind die Vorschriften vollständig erfüllt. Ansonsten ist die anteilige Erfüllung folgendermaßen zu berechnen:
Erfüllungsgrad [%] = Anteil Erneuerbare Energien [%] / 15 % × 100 %
Um den Wärmebedarf für das gesamte Jahr zu decken, ist neben der Solarthermie-Anlage in der Regel ein zweiter Wärmeerzeuger – wie eine Gasheizung – erforderlich. Solarthermie kann als Ergänzung für fast jedes Heizsystem genutzt werden.
Hybriden Anlagen sind auch im bundesweit gültigen »Heizungsgesetz« (GEG) anerkannt und man ist für die Zukunft diesbezüglich gut aufgestellt.
Übergang vom EWärmeG zum GEG (»Heizungsgesetz«) beachten!
In Baden-Württemberg können Eigentümer von Wohngebäuden, die eine neue Gasheizung installieren, ihre Verpflichtung nach dem EWärmeG und künftig nach dem GEG durch Biogas-Tarife erfüllen. Die Anteile müssen nach dem Heizungstausch stufenweise steigen: zunächst 10 %*, ab 2029 15 %, ab 2035 30 %, ab 2040 60 % und ab 2045 100 % Biogas-Anteil.
* nur in Verbindung mit einem Sanierungsfahrplan (iSFP) oder einer anderen Option, die mindestens 5 % Erneuerbare Energien gemäß EWärmeG bringt.
Kundenmeinungen
4,8 von 5 Sternen auf SHOPVOTE und Google aus 66 Bewertungen (167 insgesamt). Hier eine kleine Auswahl von Kundenmeinungen:
Cornel Leinenkugel
Google
5.00 von 5 Sternen
Wir sind mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans durch ESTATIKA sehr zufrieden. Der Kontakt war von Anfang an unkompliziert, transparent und vertrauensvoll. Der Preis war deutlich besser als von anderen Anbietern. Klare Empfehlung.
Steffen Studte
Google
5.00 von 5 Sternen
Alles zu meiner Zufriedenheit. Kurze , schnelle Kommunikation .klare Empfehlung
Über uns
Die ESTATIKA GmbH ist ein Büro für Energieberatung mit zertifizierten Energieeffizienz-Experten des Bundes. Wir bieten neben den klassischen Energieberatungsleistungen (bspw. Sanierungsfahrplan) auch Beratungsangebote zum EWärmeG/GEG, sowie zu Biogas-Tarifen an − um betroffenen Eigentümern konkrete wirtschaftliche Lösungen an die Hand zu geben.



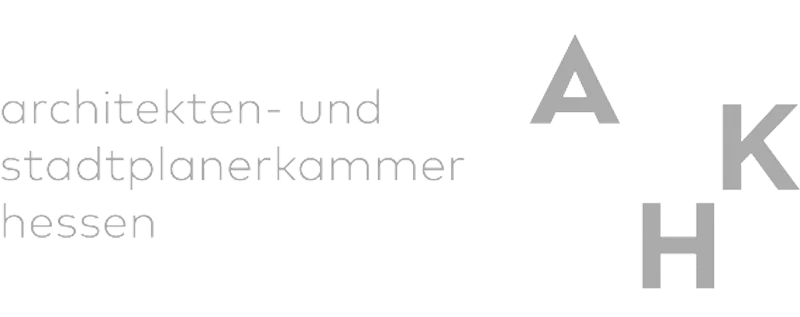
Unsere Ansprechpartner:

Dr.-Ing.
Christoph Ebbing
Energieeffizienz-Experte
–> EWärmeG & GEG

Dipl.-Vw.
Stefan Tiesmeyer
Energiewirtschaftler
–> Biogas-Tarife

Dipl.-Ing. (FH)
R. Sithamparanathan
Energieeffizienz-Experte
–> Sanierungsfahrplan
Unsere Keyfacts:
- Gründungsjahr
- 2019
- Berufsjahre
- 15+
- erfolgreiche Projekte
- 2.000+
Leistungen
Für folgende Leistungen können Sie bei uns Angebte einholen – zur Erfüllung des EWärmeG:






