Wärmenetzanschluss im EWärmeG
Der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz sowie jede andere Einrichtung zur leitungsgebundenen Wärmeversorgung von mehreren Gebäuden (bspw. ein nicht-öffentliches Wärmenetz) kann das Erneuerbare-Wärme-Gesetz als Ersatzmaßnahme vollständig erfüllen (15 %). Wärmenetze in Baden-Württemberg …
Dafür muss das Wärmenetz mit 50 % Kraft-Wärme-Kopplung, die gemäß der EU-Richtlinie 2012/27/EU hocheffizient ist, mit 15 % Erneuerbaren Energien oder mit 50 % Abwärme betrieben werden. Die Wärmeproduktion für das Wärmenetz kann auch aus einer Kombination der genannten Möglichkeiten erfolgen.
Der Wärmenetzbetreiber muss dem angeschlossenen Kunden mit einem bestätigen, dass die Anforderungen erfüllt sind.
Exkurs: Stand der Technik – Funktionsweise eines Wärmenetzes
Wärmenetze dienen der leitungsgebundenen Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Heizung, Warmwasser oder Prozesswärme. Der Transport erfolgt durch ein wärmegedämmtes Rohrsystem. Die thermische Energie wird dabei durch das Medium Wasser oder Dampf vom Wärmeerzeuger zum Verbraucher geführt. Die Wärme für das Wärmenetz kann auf unterschiedliche Art erzeugt werden. So kann die ausgekoppelte Wärme aus Produktionsprozessen wie der Stahlherstellung genutzt werden.
Weitere Wärmequellen sind Müllheizkraftwerke oder Erdgas-KWK-Anlagen. Bei dem Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung ermöglicht das Wärmenetz die Nutzung der Abwärme, die bei der Stromerzeugung sonst häufig ungenutzt bleibt. Neben der Energiegewinnung aus Gas, Kohle oder Öl steigt der Anteil Erneuerbarer Energien für den Betrieb von Wärmenetzen stetig. So wird bspw. immer häufiger die im Blockheizkraftwerk einer Biogasanlage erzeugte Wärme zur Versorgung eines Nahwärmenetzes genutzt.
Über ein Verteilnetz wird das heiße Medium zu den Verbrauchern transportiert. Der Anschluss der Gebäude an das Wärmenetz geschieht in der Hausanschlussstation und kann direkt oder indirekt erfolgen. Bei einem direkten Anschluss wird das Wasser des Wärmenetzes direkt in die Hausanlage, sprich in das Heizsystem des Gebäudes geleitet. In der Hausanschlussstation werden zuvor der Druck, der Volumenstrom und die Temperatur an die erforderlichen Parameter des Gebäudes angepasst. Bei dem indirekten Anschluss wird die Hausanlage durch einen Wärmetauscher hydraulisch vom Wärmenetz getrennt. Die Wärme wird in dem Wärmetauscher an das Heizungswasser des Gebäudes übertragen und dann mithilfe einer Umwälzpumpe durch die Hausanlage befördert.
Aufgrund der höheren Risiken im Falle eines Rohrbruchs in der Hausanlage, wird der indirekte Anschluss mit einem Wärmetauscher i. d. R. vom Fernwärmeversorger bevorzugt. Für kleinere Nahwärmenetze setzen Fernwärmeversorger häufig auf die direkte Fahrweise. Bei beiden Anschlussvarianten befindet sich ein Wärmemengenzähler in der Hausanschlussstation. Dieser erfasst die vom Gebäude abgenommene Wärme, die dem Kunden dann als sogenannter „Arbeitspreis“ in Rechnung gestellt wird.
Exkurs: Anschluss an ein Nah-/Fernwärmenetz
Bevor man einen Wärmenetzanschluss für das eigene Gebäude in Erwägung zieht, sollte man vorher recherchieren, ob ein Wärmenetz in der entsprechenden Region vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann ein Vertrag mit dem Nah-/Fernwärmeversorger abgeschlossen werden. Dieser Vertrag ist nach gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt und sollte allgemeine Vertragsdaten, eine verständliche Erläuterung der Vertragsinhalte und wesentliche Bedingungen beinhalten.
Je nach Region und Versorger, unterliegen die Kosten für Nah-/Fernwärme starken Schwankungen. In der Regel entstehen dem Kunden Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses und für die Hausanschlussstation. Einige Hersteller verlangen einen zusätzlichen Zuschuss für den Ausbau des Netzes. Für die Bereitstellung der Energie, welche auf die Anschlussleistung in Kilowatt bezogen wird, muss ein Grundpreis gezahlt werden. Hinzu kommen ein Arbeitspreis pro Kilowattstunde abgenommener Wärme und ein Messpreis für die Ermittlung des Verbrauchs und der Abrechnung. Es sollte beim Preisvergleich auf Preisanpassungsklauseln geachtet werden. Konkrete Informationen erhält man beim ausgewählten Nah-/Fernwärmeversorger.
Anteilige Berechnung im EWärmeG – Anschluss an ein Wärmenetz
Wenn nicht der gesamte Wärmeenergiebedarf durch das Wärmenetz gedeckt wird (oder die verteilte Wärme nicht den Anforderungen vollständig entspricht), ist auch eine anteilige Anrechnung nach den §§ 3 Nr. 4 und 20.6 EWärmeG durch die folgende Formel möglich:
Anteil Ersatzmaßnahme [%] = Wärmemenge Wärmenetz [kWh] / gesamter Wärmeenergiebedarf [kWh] × 15 % × KWK [%] / 50 % × Abwärme [%] / 50 % × EE [%] / 15 %
mit EE = Anteil Erneuerbare Energien an der Produktion, KWK = Anteil KWK an der Produktion, Abwärme = Anteil Abwärme an der Produktion
Ist der Wert größer oder gleich 15 %, sind die Vorschriften vollständig erfüllt. Ansonsten ist die anteilige Erfüllung folgendermaßen zu berechnen:
Erfüllungsgrad [%] = Anteil Ersatzmaßnahme [%] / 15 % × 100 %
Verbindliche Aussagen zum EWärmeG nur von Ihrer unteren Baurechtsbehörde!
Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen – beispielsweise mit dem Sanierungsfahrplan
Falls das Wärmenetz, dessen verteilte Wärme die Anforderungen nur teilweise erfüllt und/oder nur einen Anteil des jährlichen Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes deckt, ist die Kombination mit anderen Erfüllungsoptionen möglich. Es bieten sich hierbei Maßnahmen an, die unabhängig von der Erzeugereinheit durchführbar sind. Je nach Erfüllungsgrad ist in erster Linie der Sanierungsfahrplan (5 %) und die Keller‑, Außenwand- und Dachdämmung zu nennen. Auch eine gesamtheitliche Dämmung kann bezogen auf das EWärmeG aus BW interessant sein.
Der Sanierungsfahrplan wird mit bis zu 50 % vom Staat bezuschusst (Eigenanteil ab 325 €) und gilt damit als sozialverträglich.
Kundenmeinungen
4,8 von 5 Sternen auf SHOPVOTE und Google aus 66 Bewertungen (167 insgesamt). Hier eine kleine Auswahl von Kundenmeinungen:
Cornel Leinenkugel
Google
5.00 von 5 Sternen
Wir sind mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans durch ESTATIKA sehr zufrieden. Der Kontakt war von Anfang an unkompliziert, transparent und vertrauensvoll. Der Preis war deutlich besser als von anderen Anbietern. Klare Empfehlung.
ShopVoter-4010926
ShopVote
5.00 von 5 Sternen
sehr zu empfehlen
Über uns
Die ESTATIKA GmbH ist ein Büro für Energieberatung mit zertifizierten Energieeffizienz-Experten des Bundes. Wir bieten neben den klassischen Energieberatungsleistungen (bspw. Sanierungsfahrplan) auch Beratungsangebote zum EWärmeG/GEG, sowie zu Biogas-Tarifen an − um betroffenen Eigentümern konkrete wirtschaftliche Lösungen an die Hand zu geben.



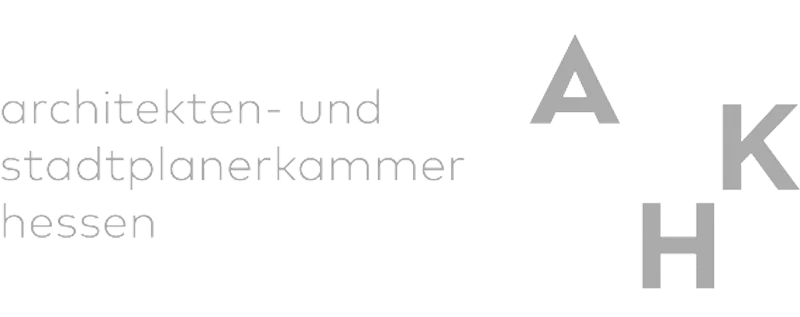
Unsere Ansprechpartner:

Dr.-Ing.
Christoph Ebbing
Energieeffizienz-Experte
–> EWärmeG & GEG

Dipl.-Vw.
Stefan Tiesmeyer
Energiewirtschaftler
–> Biogas-Tarife

Dipl.-Ing. (FH)
R. Sithamparanathan
Energieeffizienz-Experte
–> Sanierungsfahrplan
Unsere Keyfacts:
- Gründungsjahr
- 2019
- Berufsjahre
- 15+
- erfolgreiche Projekte
- 2.000+
Leistungen
Für folgende Leistungen können Sie bei uns Angebte einholen – zur Erfüllung des EWärmeG:






